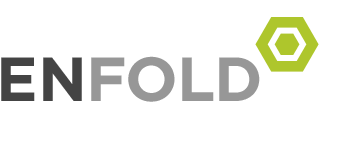Angesichts der nahenden finalen Entscheidungen im Parlament und der öffentlichen Diskussion um das Gemeinnützigkeitspaket melden wir uns mit einem Update und einer Bewertung:
Das Gemeinnützigkeitspaket mit der Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit ist morgen im Parlament im Finanzausschuss und soll am 13.12. endgültig beschlossen werden. Damit ist auch ein In-Kraft-Treten mit 1.1.2024 gesichert.
Davon werden 45.000 Vereine profitieren. Tierschutz-, Bildungs- und Menschrechtsorganisationen erhalten neben der jetzt gesamten Kultur und dem Sport erstmals die Spendenbegünstigung. Es gibt viele Vereinfachungen für kleine Vereine etc.
In den letzten Tagen gab es auf Grund von Bedenken einzelner Organisationen hinsichtlich der Anerkennung und Aberkennung der Spendenabsetzbarkeit und der Gemeinnützigkeit einige Diskussionen. Wir haben diese Fragen intensiv im Verhandlungsprozess mit dem BMF eingebracht und das vorliegende Ergebnis stellt aus unserer Sicht eine Konkretisierung (d.h. Einschränkung des Interpretationsspielraums) und keine Verschärfung gegenüber der jetzigen Rechtslage dar. Warum gibt es unterschiedliche Interpretationen? Es gibt schlicht keine relevante Judikatur zur Aberkennung der Spendenabsetzbarkeit und Gemeinnützigkeit aus den letzten Jahren (im Übrigen auch ein Qualitätsnachweis für unseren Sektor). Wir wurden im gesamten Verhandlungsprozess hervorragend von Thomas Höhne (den ihr als Vereinsrechtsexperten entweder aus der direkten Arbeit mit ihm, aus seinem Standardwerk zum Vereinsrecht oder aus unseren Webinaren kennt) und von einigen unserer Vorteilspartner:innen aus den Wirtschaftssprüfer:innen und Steuerberater:innen fachlich unterstützt.
Zu den aufgeworfenen Punkten:
Bewertung der im Gesetzespaket vorgesehenen „Strafbestimmungen“
Die Bestimmungen zu Zuerkennung bzw. Aberkennung der Gemeinnützigkeit sowie der Spendenabsetzbarkeit basieren im Wesentlichen auf bereits bestehenden Regelungen in anderen Gesetzen.
Bereits jetzt können wiederholte schwerwiegende oder fortgesetzte Verstöße gegen die Rechtsordnung zum Entzug der Gemeinnützigkeit durch die Finanzbehörden oder zur Auflösung eines Vereines durch die Vereinsbehörde führen. Bereits nach der geltenden Rechtslage kann die Gemeinnützigkeit von der Steuerbehörde aberkannt werden, wenn wesentliche Mittel für nicht gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Hier gibt es in der Praxis immer wieder Fälle.
Der geplante Gesetzestext stellt ebenfalls klar, dass nicht jegliche Form strafbarer Handlungen zum Verlust der Spendenabsetzbarkeit führen kann. Vielmehr müsste ein erheblicher Anteil der Spenden („Mittel in nicht bloß untergeordnetem Ausmaß“ bedeutet laut Judikatur rund 10 Prozent) für die Begleichung von Strafen verwendet werden. Davon wäre laut unserem Wissensstand auch in Zukunft keine österreichische NGO auch nur annähernd betroffen. Die Behörde muss dabei auch immer die verfassungsrechtlichen Grenzen beachten, wonach insbesondere zivilgesellschaftliches Engagement durch das Versammlungsrecht streng geschützt ist. Wie auch bisher wird natürlich viel an der Vollzugspraxis liegen. Daran ändert sich nichts und es gibt die Vereinbarung mit dem BMF, dass die Vollziehung gemeinsam im gesetzlich verankerten Spendenarbeitskreis evaluiert wird.
Bewertung der fehlenden aufschiebenden Wirkung
In den Verhandlungen und auch in unserer Stellungnahme haben wir intensiv auf die fehlende aufschiebende Wirkung bei einem Rechtsmittel gegen eine Aberkennung der Spendenabsetzbarkeit und/oder der Gemeinnützigkeit hingewiesen. Im Übrigen eine Lücke, die auch aktuell besteht und damit ebenfalls im bisherigen Gesetzespaket keine Verschlechterung zum Status quo. Das ist im Übrigen auch jener Punkt den Prof. Heinz Mayer als verfassungswidrig bezeichnet hat. Hier ist weiterhin Bewegung in der Sache, wie auch Finanzminister Brunner in der Pressekonferenz am Donnerstag angedeutet hat. Zu lösen ist allerdings die Herausforderung, dass aus Sicht der Spendenorganisationen keinesfalls der/die Spender:in Jahre nach der Spende zu einer Nachzahlung der Steuer verpflichtet werden kann, wenn in der Instanz eine Aberkennung bestätigt wird. Mit gutem Willen wird sich das aber lösen lassen.
Zum Schluss noch ein Blick auf die wichtigen Punkte, die sich durch das Paket positiv verändern werden:
- die rechtliche Absicherung der Aufwandspauschale für Freiwillige
- die Ausweitung der Spendenbegünstigung auf alle gemeinnützigen Zwecke und damit auch auf Sport, Kunst und Kultur, Bildung, Tierschutz, Demokratie und Menschenrechte etc.
- die Verkürzung der Wartefrist für die Spendenabsetzbarkeit auf zwölf Monate
- die Verfahrenserleichterungen für kleine gemeinnützige Organisationen durch Antragstellung über Steuerberater:innen
- die Verwaltungsvereinfachung für beide Seiten durch Einführung eines Dauerbescheides
- die deutliche Attraktivierung von gemeinnützigen Stiftungen durch großzügigere Rahmenbedingungen bei Mittelzuwendung, Einführung der Vortragsfähigkeit und Endowmenterleichterung
- die verbesserte Rechtssicherheit durch die Änderungen in der BAO
- die Ausweitungen der Gebührenbefreiung der Strafregisterbescheinigung
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Alles Liebe,
Stefan Wallner
SERVICE: Kostenlose (Erst)-Beratung von Vereinsorganen
Haben Sie Fragen zu Vereinsgründung oder Gemeinnützigkeit? Suchen Sie nach Expertise zu vereins- bzw. steuerrechtlichen Fragen? Wir beraten und vermitteln kostenlos.
Reservieren Sie hier gleich online Ihren Beratungstermin!
MITGLIED WERDEN: Werdet Teil des Bündnis für Gemeinnützigkeit
Interesse an einer Mitgliedschaft? Gebt uns Bescheid und wir informieren euch über Vorteile und Voraussetzungen.
Mitglied werden.